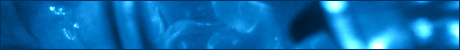Die rote Wand
Viertausend Jahre chinesische Kunst: Das Palastmuseum Taipeh zu Gast
im Alten Museum
Sebastian Preuss
[image]
Die Kunst der Himmelssöhne
Die kaiserliche Sammlung ist das Allerheiligste der chinesischen Kunst.
Nach dem Zweiten Weltkrieg gelangte sie nach Taiwan. Zehn Jahre wurde
verhandelt, bis 400 der Kunstwerke - darunter diese Kopfstütze
- nach Berlin ausgeliehen wurden. Am Donnerstag wurde die Ausstellung
im Alten Museum eröffnet. (Foto: dpa/Miguel Villagran)
Die chinesische Kunst lehrt den westlichen Betrachter ein neues Sehen.
Wo die harmonische Einheit von Bild und Text, von Form und Inhalt
zu den höchsten Idealen gehört, hat die Kunst einen Stellenwert,
den sie selbst unter Renaissance-Päpsten oder im höfischen
Barock nie besaß. Die chinesische Oberschicht im Umkreis des
Kaisershofes schmückte sich nicht nur mit den kostbaren Porzellanen,
Seidenmalereien und ausdrucksvollen Kalligrafien. Der Kunstkenner
sollte das Artefakt geistig durchdringen, sich in das Werk versenken
und in jahrelangem Studium mit dem Künstler kommunizieren. Wer
etwas gelten wollte in der höfischen Hierarchie, übte sich
in der Naturmalerei, in Gedichten und gelehrten Texten und vor allem
in der Schriftkunst, dem Mittelpunkt aller chinesischen Kultur.
Das Staunen hat verlernt, wer sich von der Feinheit und der Raffinesse
der kaiserlichen Preziosen, die ab heute im Alten Museum in verschwenderischer
Fülle ausgebreitet sind, nicht forttragen lässt. Doch können
wir diese atemberaubenden Schätze überhaupt verstehen, die
das Palastmuseum in Taipeh ausgeliehen hat? So komplex sind die philosophischen
und literarischen Zusammenhänge dieser Kunst, dass zu ihrer Entstehungszeiten
selbst die Eliten lange ausgebildet werden mussten, um sie in ihrem
ganzheitlichen Gehalt würdigen zu können. In einer Kultur,
in der Kunstkennerschaft zu größter Ehre verhalf, Staatsbeamten
auf ihre geisteswissenschaftlichen Kenntnisse geprüft wurden
und die Kaiser selber mit den besten Kalligrafen ihrer Epoche wetteiferten,
in solch einer Kultur schwebt die Kunst über allem und durchdringt
zugleich jeden gebildeten Menschen im täglichen Leben.
Das Allerheiligste der chinesischen Kunstgeschichte ist die kaiserliche Sammlung, die sich bis in die Shang-Dynastie des zweiten vorchristlichen Jahrtausends zurück verfolgen lässt und heute zum allergrößten Teil in Taipeh verwahrt wird. Zehn Jahre haben Wenzel Jacob und seine Mitarbeiter der Bundeskunsthalle in Bonn mit Taiwan verhandelt, bis das Palastmuseum 400 seiner wertvollsten Stücke aus ehemaligem Kaiserbesitz nach Deutschland auslieh. Als letzte Hürde musste die Stiftung Preußischer Kulturbesitz für nächstes Jahr eine hochrangige Gegenausstellung über die deutsche Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts zusagen.
Mit Zweitklassigem wird Berlin schwerlich auf die Großzügigkeit Taipehs antworten können. Taiwan hat zwar nicht seine Sixtinische Madonna ausgeliehen, das in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts entstandene Landschaftsbild des Malers Fan K'uan, der die Naturdarstellung für Jahrhunderte prägte. Doch hat Taipeh - der Vergleich mag hinken - Tizian, Dürer, Rembrandt, fast alle größten Meister ausgeliehen. So stehen die duftigen, wie Wolkentürme in den Himmel stoßenden Berglandschaften aus der Zeit der Sung-Dynastie (960-1279) Fan K'uans Hauptwerk nur wenig nach.
Welche Bedeutung das Palastmuseum dieser Ausstellung als Botschafterin seines immer noch von wenigen Staaten nur anerkannten Landes beimisst, zeigt sich an der Handrolle, auf die der Sung-zeitliche Dichter Su Shih sein "Gedicht über die Rote Wand" kalligrafierte. Es ist die Urfassung eines der berühmtesten Werke der chinesischen Literatur, Deutschland müsste im Gegenzug eigentlich das Manuskript von Goethes "Faust" entsenden. Oder die kostbare Steinabreibung des 11. Jahrhunderts, die die Schriftzeichen von Wang Hs-chih aus dem vierten Jahrhundert überliefert: Für die Geschichte der chinesischen Schreibkunst gibt es kaum ein wichtigeres Werk. Wang Hs-chih verwandelte die Siegel- und Kanzleischriften zu der frei fließenden Konzeptschrift; die Kalligrafie wurde damit endgültig zum zentralen Medium der Ästhetik und der praktizierten Selbstkultivierung im Sinne des konfuzianischen Ideals. Wertvolleres als dieses Gründungswerk einer ganzen Kunstgattung kann ein Museum nicht auf die Reise schicken.
Spätestens seit dem fünften Jahrhundert dienten die Kunstsammlungen den Kaisern als Symbol ihres Himmelsmandats. Zu Regierungsantritt nahmen die "Himmelssöhne" die Schätze demonstrativ in Besitz, versahen sie mit ihren Siegeln, oft auch mit kalligrafischen Kommentaren, die den Malereien und Schriftrollen eine zweite Sinnschicht verliehen. Die Mehrung der Schätze gehörte zu den zentralen Aufgaben des kaiserlichen Selbstverständnis, wenngleich nicht alle Herrscher so exzessiv und zugleich so kennerhaft sammelten wie Ch'ien-lung im 18. Jahrhundert. Seit dem 11. Jahrhundert ließen die Kaiser ihre Kollektionen katalogisieren und erforschen, weshalb sich in China die Spuren von Künstlern und Werken sehr viel früher und genauer verfolgen lassen als in allen anderen Kulturen.
Der Mythos der kaiserlichen Sammlung speist sich heute nicht zuletzt aus ihrem Schicksal seit dem Untergang der Ch'ing-Dynastie im Jahr 1911. Noch nach seiner Vertreibung aus der Verbotenen Stadt verschleuderte der letzte Kaiser P'u-yi Kostbarkeiten zur Finanzierung seines Lebensstils. Die Republik aber erkannte bald die legitimierende Symbolkraft der Schätze und gründete 1925 das Palastmuseum. Vor den japanischen Invasoren wurden 1933 über 19 000 Kisten aus Peking evakuiert. Zwölf Jahre dauerte die Odyssee auf der Flucht vor der Front, über 600 000 Objekte überdauerten den Krieg.
Als Chiang Kai-shek vor den Kommunisten nach Taiwan auswich, ließ er im Winter 1948/49 auch das Palastmuseum auf die Insel verschiffen. In der Tradition der kaiserlichen Herrschaftslegitimation betrachtete die Nationalregierung die Sammlung als eine Art Faustpfand für ihren Machtanspruch über ganz China. Erst 1965, als sich der Status Quo festigte, wurde das imperiale Erbe im neuen Palastmuseum in Taipeh wieder vollständig zugänglich.
In Berlin ruft die kostbare Schau aber auch in schmerzliche Erinnerung,
dass 90 Prozent des Museums für Ostasiatische Kunst noch in russischen
Beutedepots lagern. Zugleich führt sie vor Augen, mit welchem
Gewinn die außereuropäischen Kulturen den abendländischen
Kanon auf der Museumsinsel auf Dauer ergänzen könnten. Doch
sind die Planungen für das Schloss, wo die kaum besuchten Dahlemer
Bestände eine würdige Heimat finden sollen, ins Stocken
geraten. Die verantwortliche Bundestagskommission kann jetzt ihren
Elan durch einen Ausflug in diese wunderbare Ausstellung auffrischen.
http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/feuilleton/261126.html