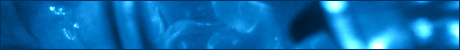[achtung! kunst] *Venice 1* Opener: Tsui Harks "Qi Jian"
Welt, 1. September 2005
Sieben Schwerter für den Frieden
Das Filmfestival in Venedig ist sehr auf Sicherheit bedacht - und
eröffnet mit einer Kriegstreiberei: Tsui Harks "Qi Jian"
von Peter Zander
Die Löwen stehen wieder. Als sie im vergangenen Jahr erstmals vor dem Palazzo del Cinema aufgebaut wurden - protzige, güldene Statuen auf farbig bestrahlten Stelen -, stießen sie auf hämische Kritik. Schien ihre strenge Aneinanderreihung doch martialisch, militärisch, ja, dieses Wort fällt oftmals ziemlich schnell in Italien, faschistoid.
Die Löwen schauen nicht weniger trotzig in diesem Jahr, doch ihre Wirkung ist milder. Denn das Drumherum zeigt sich noch viel martialischer. Absperrzäune überall, Polizisten, die in Legionenstärke patrouillieren, riesige Metalldetektoren, durch die das Publikum muß. Die 62. Filmfestspiele in Venedig gerieren sich als Filmfestung, als Hochsicherheitstrakt.
Die Angst geht um am Lido. Angst vor dem Terror. Angst, das Festival, das einen Tag vor dem 11. September zu Ende geht, könnte - nach Spanien und Großbritannien - das nächste Ziel eines Anschlags sein. Obwohl die Ziele bislang eben nicht prominente Ereignisse waren, sondern das gemeine Alltagsleben, zeigt sich das Festival sichtbar nervös. Ein Gefühl, das sich auf den Besucher überträgt. Wer sich bislang auserwählt fand, einer Premiere beizuwohnen, kommt sich diesmal eher wie ein Verdächtiger, ja wie ein Sträfling vor.
Da scheint es eine bittere Ironie, daß Festivalchef Marco Müller einen Eröffnungsfilm gewählt hat, der in Mord und Totschlag badet und, grob vereinfacht, ein Plädoyer fürs Kämpfen darstellt: Tsui Harks "Qi Jian (Seven Swords)". Das asiatische Kino ist stark vertreten, in allen Sektionen, bis hin zu einer Retrospektive, einer Hommage an Anime-Meister Miyazaki Hayao - und dieser Martial-Arts-Oper als Vorspeise.
"Seven Swords" entführt ins 16. Jahrhundert, doch die Bösen tragen Fantasy-Uniformen und bizarre Tatoos. In jener Zeit kommt die Ching-Dynastie an die Macht, und um Revolten im Keim zu ersticken und das Reich zu kontrollieren, wird die Ausübung von Martial Arts strikt verboten. Alle Kämpfer müssen sterben. Als letzte Bastion, das klingt nach Asterix, steht ein Dorf, das der Tyrannei Widerstand leistet, aber erst den Schutz erfahrener Krieger braucht - und deren sieben Schwerter.
Einst haben die Amerikaner den asiatischen Film mit den "Sieben Samurai" entdeckt, haben daraus gleich "Die glorreichen Sieben" ins Western-Genre umgetopft. "Seven Swords" kehrt das wieder um, zeigt dem Westen, der spätestens seit "Matrix" nicht mehr ohne asiatische Kampfkunst auskommt, welche Kunst sich dahinter verbirgt und welche Philosophie. Das Martial-Arts-Genre stößt hier auf sein ureigenes Selbstverständnis: die Pflege einer originären Kultur. Wer will, mag in der Filmrevolte gar ein verstecktes Plädoyer für Unabhängigkeitsbestrebungen gegen die chinesische Übermacht lesen.
Tsui freilich geht es um anderes. Er ist ein Meister seines Fachs; trägt quasi den schwarzen Gürtel der "Wuxia", wie das Genre in Asien genannt wird, und hat darin Standards gesetzt. Mit "Seven Swords" möchte er einen radikalen Neuanfang wagen: Weg von den visuellen Effekten, den krassen CGI-Tricks und den jegliche physikalische Gesetze außer Kraft setzenden Martial-Arts-Werke der letzten Zeit. Bei ihm wird nicht geschwebt, nicht geflogen. Hier werden zumindest die Kämpfe realistischer und authentischer choreographiert.
Die Bösen wirken dennoch wie überzeichnete Comic-Karikaturen. Tsui knüpft sogar direkt an "Sin City" an, wenn er anfangs jegliche Farbe eliminiert und Blut und Fahnen in dickes Rot taucht. Doch diese Stilisierung wird nicht durchgehalten, im Gegenteil, das Landleben erscheint in fette Farben, der Film ersäuft mit westlicher Kitsch-Musik und omnipräsenten Sonnenuntergängen. Willkommen in der Rama-Werbung.
Tsui Hark ist kein Ang Lee ist und kein Zhang Yimou, asiatische Regisseure, die die Wuxia in "Tiger & Dragon" oder "Hero" zu poetisieren wußten. Die einzige Liebe, die in diesem Film zählt, ist jene zur Waffe. Das wird zuletzt sogar den überlebenden Dorfkindern, der Next Generation, als bedeutsamer Erziehungsauftrag mit auf den Weg gegeben. "Sie werden", so die sehr düstere Prophezeiung, "noch mehr Mörder schicken. Der Kampf ist noch nicht zu Ende." Da sind dann wir wieder mitten in der Gegenwart - und auf dem verschanzten Lido.
http://www.welt.de/data/2005/09/01/768432.html
***************************
Auftakt in Venedig
Welt am Draht
Von Dirk Schümer, Venedig
01. September 2005 Wie der Western, so ist auch der Kung-Fu-Film
ein im besten Sinne reaktionäres Genre. In Amerika erklärte man im
Zeitalter der Atombombe westwärts reitende Pistoleros zu Helden, in
der chinesischen Kultur wurden, exakt nach dem Kollektivrausch der
Kulturrevolution, durchtrainierte Schwertkämpfer zu individuellen
Heilsbringern.
[image] Zhang Jingchu ist der Star im Eröffnungsfilm "Sieben
Schwerter"
Der in Vietnam geborene und in Texas ausgebildete Hongkong-Chinese
Tsui Hark hat das weltweit erfolgreiche Genre der akrobatischen Kampf-Epen
Ende der siebziger Jahre recht eigentlich begründet - für Venedigs
Festivaldirektor Marco Müller, der außer Cineast auch Sinologe ist,
Grund genug, mit Tsui Harks monumentalem Epos „Sieben Schwerter” die
diesjährigen Filmfestspiele am Lido zu eröffnen. Doch was als Hommage
an das asiatische Kino gedacht war, erweist sich als monumentale Beerdigung.
[image]Regisseur Tsui Hark präsentiert in Venedig den Eröffnungsfilm
Altbekannte Geschichte
„Sieben Schwerter” erzählt die altbekannte Geschichte von ebenso vielen Helden, die uneigennützig ein Bauerndorf vor der Aggression brutaler Gangsterbanden verteidigen und sich mit Todesverachtung der Übermacht stellen. Akira Kurosawa hat den Stoff für seine stilbildenden „Sieben Samurai” japanisiert, John Sturges den Westernklassiker „Die glorreichen Sieben” daraus abgeleitet. Tsui Hark hat jedoch alles Recht, sich der Thematik erneut anzunehmen, schließlich liegt allem ein chinesischer Romanklassiker über die Kämpfe zwischen zentralisierendem Kaiserreich und widerspenstigen Dorftruppen bald nach 1600 zugrunde.
Der Regisseur hat während der Dreharbeiten in der versteppten Nordwestprovinz
Xingjiang und auf mehr als dreitausend Meter Seehöhe im mythenverhangenen
Tian-Shan-Gebirge erklärt, sich fortwährend von seinem Meister Kurosawa
entfernt zu haben; es handele sich eben um rein chinesische Geschichte.
In Wahrheit aber trennt beide Meister nicht das Gelbe Meer, sondern
die Erfindung des Digitalbildes. Das gemächliche Tempo der Samurai,
Kurosawas geheimnisvolle Schattenbilder sind ersetzt durch einen Wirbelsturm
an Kampfszenen, geschnitten im Zehntelsekundenrhythmus mit Strömen
von Blut und Feuer.
[image] Drei Frauen mit "Sieben Schwertern": Kim So Yeun
(l.), Charlie Yeung (r.) und Zhang Jingchu
Vom eigenen Genre niedergewalzt
Der Regisseur wird hier förmlich von seinem eigenen Genre niedergewalzt, denn die Ödnis der zahllosen Gefechte schreit nach einer wenigstens anekdotischen Auflockerung: Originelle Waffen wie fliegende Rasierscheiben, Bumerangmesser, Eisennetze und zuckende Hellebarden sind etwa das, was ähnliche Apparaturen für den Pornofilm bedeuten, der ja mit demselben Verhängnis des Immergleichen kämpft. Man darf Tsui Hark abnehmen, daß er alles versucht hat, um die „betäubende Wirkung der Spezialeffekte” zu minimieren. Was sich an Kampfballett und Flugnummern mit verdrahteten Schauspielern längst verbraucht hat, soll durch penible Kostümierung und endlosen Funkenflug historisch eingeordnet und damit glaubhafter werden.
Doch die Ära des Kung-Fu-Films ist mindestens so passé wie die des
Westerns. „Sieben Schwerter” ist nichts anderes als der erwartbare
Märchenfilm mit automobilen Waffen und bis zur Lächerlichkeit eindimensionalen
Helden. Da nutzt der politisch korrekte Einbau zweier unterdrückter
Koreaner und einer quirligen Kung-Fu-Meisterin für den panasiatischen
Markt nichts. Was der Regisseur mit seiner Ankündigung meinte, „komplexe
Gefühle” rund ums Kampfgeschehen darzustellen, das bleibt bei edelmütigen
Bauern, opferwilligen Greisen und sprungstarken Asketen wie aus dem
Mao-Kino sein Geheimnis.
[image] Festivaldirektor Marco Müller
Leistungsschau von Gymnastik und Pferdedressur
Letzlich überzeugt der Film trotz einiger in China populärer Fernseh- und Schlagerstars nur als Leistungsschau von Gymnastik, Pferdedressur und Säbelfechterei. Sollten die Beteiligten in diesen Disziplinen bei den nächsten Olympischen Spielen antreten, dürfte China der erste Platz im Medaillenspiegel nicht zu nehmen sein. Vor allem aber die grotesk kitischige Synthesizermusik verrät, daß es hier überhaupt nicht um ein Zurück zu den altchinesischen Wurzeln ging, denn dann hätte man sich der wundervoll spröden Musiktradition mit Saiteninstrumenten und Flöten bedient.
Nein, hier wird - wie bei Fernost-Jeans oder China-Computern - ein amerikanisches Erfolgsmodell kopiert. Hier ist es der kalte Actionfilm, der in ostasiatische Gewänder verpackt und für den Videospiel-Weltmarkt der schnellen Bilder aufbereitet wird. Im Angesicht routiniert hingemähter Hekatomben rollender Köpfe und aufgeschlitzter Bäuche wirken das minutenlange weinerliche Lamento um ein ausgewildertes Pferd oder die romantische Feier erhabener Heimatlandschaft nur um so obszöner. Die große taoistische Kampfschule des Kung Fu hinterließ als obersten Lehrsatz: Die höchste Kunst des Kämpfens besteht darin, nicht zu kämpfen. Schade, daß diese fernöstlichste aller fernöstlichen Weisheiten noch nicht im Kino angekommen ist.
Text: F.A.Z., 01.09.2005, Nr. 203 / Seite 33
Bildmaterial: REUTERS, AP, Festival
http://www.faz.net/s/Rub8A25A66CA9514B9892E0074EDE4E5AFA/Doc~EF9D5BEE282 B44B448A6282024E999897~ATpl~Ecommon~Scontent.html
__________________
with kind regards,
Matthias Arnold
(Art-Eastasia list)
http://www.chinaresource.org
http://www.fluktor.de
__________________________________________
An archive of this list as well as an subscribe/unsubscribe facility is
available at:
http://listserv.uni-heidelberg.de/archives/art-eastasia.html
For postings earlier than 2005-02-23 please go to:
http://www.fluktor.de/study/office/newsletter.htm