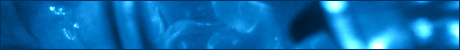[achtung! kunst] *deutschsprachiges Gebiet* : Bern: Sammlung Sigg (2x) - Bonn: Dschingis Khan und seine Erben - Berlin: Liu Sola
der bund, 11. Juni 2005
«Sigg ist für uns eine Art Priester»
Das Kunstmuseum Bern präsentiert mit «Mahjong» die grösste Sammlung chinesischer Gegenwartskunst
Morgen eröffnet das Kunstmuseum seine bisher umfangreichste Ausstellung. Rund 340 Werke aus der legendären Sammlung von Uli Sigg geben auf 3000 m2 erstmals einen repräsentativen Überblick über die chinesische Kunst von 1979 bis heute.
Originalseite als PDF:
http://www.espace.ch/artikel_103397.html
*****
zur sache:
Ai Weiwei ist Künstler, Architekt und Ko-Kurator der Ausstellung «Mahjong» in Bern.
«bund»: Ai Weiwei, Sie sind ein wichtiger Vermittler zwischen China und dem Westen. Wie kam es dazu?
Ai Weiwei: Ich bin in China aufgewachsen, war dann zwölf Jahre in New York und lebe nun seit zwölf Jahren wieder in Peking. Ich kenne beide Welten.
Sie erklären also den Westlern, wie die Chinesen funktionieren, und umgekehrt?
Ja, denn die Unterschiede sind enorm, im Denken, in der Philosophie, im Lösen von Problemen. Im Westen geht man viel rationaler, pragmatischer und wissenschaftlicher an die Dinge heran. Die Chinesen hingegen fühlen sich stärker als Teil der Natur und akzeptieren eher den Lauf der Dinge.
Hat sich das in der letzten Zeit nicht etwas geändert?
Doch, denn es ist klar, dass sich unser Land, wenn es global mithalten will, öffnen muss – was ja übrigens schon vor hundert Jahren ein Stück weit geschah, als man die Ideen von Karl Marx politisch nutzte. Heute eignet man sich das Know-how westlicher Firmen an, allerdings immer im Bewusstsein, dass es sich um ein geliehenes Werkzeug handelt. Die Chinesen sind eher skeptische, aber auch praktische Leute, die schnell lernen.
Was erfährt man in der Ausstellung «Mahjong» über China?
Die Ausstellung ist ein sehr guter Spiegel der sozialen und gesellschaftlichen Entwicklung unseres Landes in den letzten 25 Jahren. Zudem ist es für Europäer sicher spannend, mit China ein System kennen zu lernen, das funktioniert und in sich absolut Sinn macht, das jedoch komplett anders ist als dasjenige Westeuropas. Uli Sigg nannte mir dies auch einmal als einen wichtigen Grund für seine China-Faszination.
Dank ihm kam die wichtigste Sammlung chinesischer Gegenwartskunst zusammen. Wie hat er das geschafft?
Uli Sigg ist ein sehr intelligenter Mann. Vor allem aber ist er sehr hartnäckig, was absolut nötig war, um diese Sammlung überhaupt aufzubauen. Er liess nicht locker, reiste in die hintersten Ecken Chinas. Dass er all dies tat, grenzt fast an ein Wunder.
Vertrauen die Künstler ihrem Sammler?
Ja, er ist eine Art Priester für sie. Gut ist, dass Sigg Chinesisch spricht, denn viele Künstler würden ihn sonst gar nicht im Atelier empfangen.
Mit Ihrer neolithischen chinesischen Vase, die Sie mit einem Coca-Cola-Logo bemalten, wurden Sie weltberühmt. Was beschäftigt Sie im Moment?
In meiner neusten Fotoarbeit zeige ich provisorische Landschaften. Es sind Aufnahmen von Baustellen in genau dem Moment, wenn ein altes Gebäude bereits abgebrochen und das nächste gerade noch nicht gebaut wurde. In China geht das rasend schnell, mit jedem Tag verändert sich das Stadtbild von Peking: ein Phänomen.
*****
Leben mit Mao und Konsum
Das Kunstmuseum Bern präsentiert mit «Mahjong» die grösste Sammlung chinesischer Gegenwartskunst
Morgen eröffnet das Kunstmuseum seine bisher umfangreichste Ausstellung. Rund 340 Werke aus der legendären Sammlung von Uli Sigg geben auf 3000 m2 erstmals einen repräsentativen Überblick über die chinesische Kunst von 1979 bis heute.
Untrennbar zur uniformen Reihe verbunden, kniet ein gutes Dutzend Männer hintereinander am Boden. Der Einzelne kann nicht ausscheren, einzige Strategie des Überlebens ist ein böses Grinsen: Es ist dasjenige des Künstlers Yue Min Jun selbst. Dieser ist einer von 180 chinesischen Künstlern, deren Werke nun erstmals überhaupt in grossem Stil gezeigt werden. Ausstellungsort ist primär Bern, ergänzend dazu sind im aargauischen Holderbank in zwei alten Lagerhallen der Firma Holcim 25 grossformatige Werke zu sehen.
All diese Werke gesammelt hat der Schweizer Geschäftsmann und Diplomat Uli Sigg, der zusammen mit seiner Frau seit den Neunzigerjahren rund 1200 Werke chinesischer Künstler zusammengetragen hat (siehe «Bund» vom 30. April). Dass diese systematisch angelegte Sammlung von Weltrang nun erstmals als solche in Bern gezeigt wird, ist vor allem Bernhard Fibicher, dem ehemaligen Kunsthalle-Leiter, zu verdanken. Als China-Kenner hat er den Kontakt des Kunstmuseums zu Uli Sigg hergestellt. Gemeinsam mit dem international renommierten Künstler Ai Weiwei, der auch als Berater der Architekten Herzog & Demeuron in China fungiert, hat Fibicher nun die Ausstellung in Bern kuratiert.
«Mahjong» als Raster
Der Ausstellungstitel «Mahjong» lehnt sich an das gleichnamige chinesische Spiel an, dessen 144 Steine beliebig viele Auslegeordnungen zulassen. In diesem Sinn ist auch die Anordnung der Werke zu verstehen, die sich lose in zwölf Themenbereiche gliedern, von «Mao und die Kulturrevolution» über «Mythen und Legenden» bis hin zu «Konsumismus». Dies geschah auch auf Wunsch von Uli Sigg, der den Aufbau der Ausstellung bis zur Hängung der Bilder mitbegleitete. Bis kurz vor Schluss hat der Sammler sogar noch neue Werke erworben, die im letzten Moment noch in die Ausstellung integriert wurden.
Kalligrafie und Körper
Uli Sigg sieht seine Sammlung als «Materialfundus». Ein Rundgang durch die Ausstellung zeigt denn auch nicht einfach «die» chinesische Kunst, sondern eine riesige Vielfalt an Ausdrucksmöglichkeiten von Künstlern aus einem Land, das sich erst seit Ende der Siebzigerjahre, mit dem Beginn der Reformpolitik der Ära nach Mao, zunehmend zum Westen geöffnet hat. Der bis dahin von der Kommunistischen Partei vorgeschriebene sozialistische Realismus hat viele Künstler geprägt, wie die zahlreichen Persiflagen auf die Figur Maos deutlich machen. Andere Werke im Ausstellungssektor «Machtspiele» beziehen sich explizit auf die Niederschlagung der Demokratiebewegung auf dem Tiananmen-Platz 1989. Dieses Ereignis kennzeichnet auch eine Phase zunehmender Hinwendung der Künstler zum Westen, das Spielen mit der Pop-Art oder den Ideen Marcel Duchamps, gefolgt von der Auseinandersetzung mit der westlichen Konsumwelt: Hamburger, Cola und Chanel-Werbung aus chinesischer Sicht.
Dass sich viele Künstler dabei bewusst auf ihre Tradition und ihr Handwerk beziehen, sei erst seit etwa zwölf Jahren der Fall, sagt Bernhard Fibicher. Eindrücklich kommt dies im Umgang mit der Kalligrafie zum Ausdruck, wenn tradierte Zeichen ad absurdum geführt werden oder reale Dinge wie fotografierte Fliegenbeine auf einem Rollbild erscheinen. Vom Spiel mit der Tradition zeugen aber auch poppige Stickbilder oder die riesigen Porzellan-Knochen im Eingangsbereich des Museums. Auf die chinesische Medizin schliesslich bezieht sich ein raumfüllender Kürbis aus Holz, in dessen Innerem sich getrocknete Ingredienzien in Pillen wie Pferdeäpfel zu verwandeln scheinen.
Nebst zahlreichen Fotografien dominiert jedoch die Malerei, die meist figurativ und bunt ist: schmerzvoll verzerrte, ernste oder lächelnde Köpfe blicken einem da entgegen, was in den kleinen Räumen des Museums teils fast bedrängend wirkt. Zu den schönsten Räumen zählen klar der Fest- und der Hodlersaal, die je einem Künstler – Qiu Shihua und Xie Nanxing – und ihren grossformatigen monochromen Werken gewidmet sind. Zum Berührendsten und Befremdlichsten zugleich gehören in ihrer Unmittelbarkeit viele Werke aus dem Bereich «Das Medium Körper», darunter der mit Fleisch eingepackte Zhang Huan, der im Lauf der Ausstellung mit einer Performance zu Gast sein wird. Ein weiterer Höhepunkt der Ausstellung ist das Modell der Stadt Peking von Lu Hao, das – umgeben von Ai Weiweis raumfüllender Fotoarbeit (siehe Interview) – in Holderbank zu sehen ist. Warum, kann man sich einzig fragen, hat man nicht in Bern einen passenden Raum dafür gefunden?
Typisch chinesisch?
Inzwischen ist die chinesische Kunst auf dem westlichen Kunstmarkt ein begehrtes Gut. Matthias Frehner erklärt sich dieses Phänomen damit, dass es Mitte der Neunzigerjahre in der westlichen Gegenwartskunst zu gewissen Ermüdungserscheinungen gekommen und das Innovative der chinesischen Kunst dadurch besonders deutlich geworden sei. Braucht der Kunstbetrieb also immer wieder eine Blutauffrischung durch eine neue Optik auf unsere Welt? Was überhaupt ist das Typische der chinesischen Kunst? Gemäss einer erhellenden Umfrage, die Uli Sigg unter den Künstlern selbst anstellte und die im Ausstellungskatalog dokumentiert ist, gibt es für die meisten von ihnen keine «chinesische Kunst», sondern einzig Kunst von Chinesen, unter denen jeder seine eigene Sichtweise hat. Die üppige Berner Ausstellung führt dies auf grossartige Weise vor Augen. Sie macht bekannt mit einem unbekannten Land und hält dem Westen durch den Blick von aussen auch den Spiegel vor.
[i] Die Ausstellung «Mahjong – Chinesische Gegenwartskunst aus der Sammlung Sigg» wird morgen Sonntag um 11 Uhr im Stadttheater Bern eröffnet. Die Ausstellung in Holderbank (mit der SBB von Aarau oder Brugg erreichbar) dauert vom 21. Juni bis zum 28. August (Di bis Sa 14–18 Uhr), die von der Credit Suisse gesponserte Ausstellung im Kunstmuseum Bern dauert bis zum 16. Oktober. Das Rahmenprogramm beginnt mit zwei Vorträgen: Der Kunstkritiker Li Xianting spricht am 13. Juni um 19.30 Uhr, der Architekt Yung Ho am 16. Juni um 19.30 Uhr. Katalog Fr. 65.– (Buchhandel Fr. 83.–), www.kunstmuseumbern.ch.
http://www.espace.ch/artikel_103397.html
***************************
Berner Zeitung, 09.06.05
DIE SAMMLUNG SIGG IM KUNSTMUSEUM BERN UND IN HOLDERBANK AG
So lebt und bebt das heutige China
Ein Muss, ein internationales Kunstereignis: Das ist die Ausstellung «Mahjong» im Kunstmuseum Bern und in Holderbank AG. Sie zeigt junge chinesische Kunst der Sammlung von Uli Sigg – und das Bild des neuen China.
Konrad Tobler
«Alles, was sich auf der Welt abspielt, spiegelt sich im heutigen China», beschreibt Ai Wei Wei die Extremsituation in seinem Heimatland. «Bei uns findet die grösste Revolution seit Menschengedenken statt.» Ai Wei Wei – der Nachname wird in China vorangestellt – muss es wissen. Der Architekt und Künstler dokumentiert in Videos und Fotografien seit Jahren die sichtbaren, gewaltigen Umwälzungen in Peking, wo wie in den anderen Zentren wie Shanghai kein Stein auf dem anderen zu bleiben scheint, wo ganze Quartiere abgerissen werden und in kürzester Zeit Neubauten aus dem Boden schiessen.
Grosse Reise nach China
«Wenn ich nach zwei Monaten zurückkehre, ist alles anders», sagt Ai. Der 48-jährige Künstler ist zusammen mit Bernhard Fibicher, Exdirektor der Kunsthalle Bern und China-Kenner, verantwortlich für die weltweit mit rund 350 Kunstwerken bisher bedeutendste Ausstellung aktueller chinesischer Kunst, die am Sonntag im Kunstmuseum Bern und im aargauischen Holderbank eröffnet wird. Dort sind in den Lagerhallen der Holcim-Gruppe die extremsten Grossformate ausgestellt.
Auch wer noch nie in China war, erhält hier – dank der Sammlung von Uli Sigg (siehe unten), dank einer hervorragenden Inszenierung und dank Sponsoren wie der Credit Suisse – einen bleibenden, manchmal irritierenden oder für westliche Augen kaum nachvollziehbaren Einblick in die chinesischen Zustände und Befindlichkeiten. Tabus gibt es dabei keine. Sexualität, Gewalt und Tod: Die Bandbreite der menschlichen Existenz kommt in teils monumentalen Gemälden, in Videos oder Fotografien zum Ausdruck. Es ist, als ob sich die Künstlerinnen und Künstler ihrer eigenen, zerbrechlichen Gegenwart versichern wollten.
Mao und sein Sexleben
Schonungslosigkeit gilt auch fürs Gestern. «Mao-Bilder und -Utensilien», erzählt Eva Lüdi Kong, eine Übersetzerin, die seit 15 Jahren in China lebt, «findet man mittlerweile haufenweise auf den Flohmärkten.» Ebenso despektierlich behandelt wird der einst Hochverehrte und Hochgejubelte in der Kunst: Mao als Sexmaniac, der er war, der «Grosse Steuermann» hinter Gittern, Mao mit der Geste des grossen Führers ein Taxi herbeiwinkend, als ob er eine Figur in einem Computerspiel wäre: Die Kunst schreckt davor nicht mehr zurück – und bedient sich dabei der Bildersprache, die seit der Revolution 1949 die einzig erlaubte war. Listig, bissig und ironisch wird der in der Ausstellung ebenfalls dokumentierte sozialistische Realismus mit seiner plakativen Formensprache zitiert. «Zynischen Politrealismus» nennt Uli Sigg diese Strömung.
Tabubrüche noch und noch: Anfang der Achtzigerjahre, als China wirtschaftlich aufbrach, als sich auch die Künstler von den engen Korsetts befreiten, war das alles noch streng verboten. Die aufmüpfige junge Kunst fand im Untergrund statt.
Kunst als Exportschlager
Das änderte sich erst nach 1999, als der kürzlich verstorbene Berner Ausstellungsmacher Harald Szeemann Teile der Sammlung Sigg an der Biennale von Venedig präsentierte. China und seine Kunst gerieten in den Fokus der internationalen Kunstwelt. Die chinesische Kunst erlebte – darin der Ökonomie Chinas vergleichbar – einen Boom, auch auf dem Kunstmarkt.
«Dieser Boom hat die chinesischen Behörden aufgeweckt», sagt Sigg, «auch das offizielle China, das Kulturministerium und die Akademie der Künste in Peking haben sich den experimentellen Strömungen gegenüber geöffnet.» Die Kunst ist ein gutes Aushängeschild und ein perfekter Exportschlager. Ende der Zensur? Eva Lüdi Kong hat beobachtet, dass die Zensur nur dann eingreife, wenn heute lebende und aktive Politiker betroffen sind.
Spiel mit Suchtpotenzial
«Die Sammlung Sigg gibt wie ein Spiegel wieder, was in China in den letzten 25 Jahren passiert ist», lobt Ai Wei Wei den Pionier, dessen 1500 Werke umfassende Kollektion selbst in China keine Entsprechung hat. Umso schwieriger, so lässt sich leicht vorstellen, in diese Fülle eine Ordnung zu bringen und den China-Spiegel in die Ausstellung zu übertragen.
Fibicher und Ai fanden einen Trick, der aus China stammt: Sie liessen sich vom alten und jetzt auch auf 354 000 deutschen Seiten auf dem Internet weit verbreiteten «Mahjong» inspirieren, einem dem Jass vergleichbaren, aus 144 Steinen bestehenden Kombinationsspiel, das bis zur Sucht führen kann. «Das Spiel bildet die perfekte Metapher für unsere Ausstellung. Eine Kunstsammlung strebt immer das Ideal der Vollständigkeit an (144 Steine) und bildet mit der Zeit Schwerpunkte. Aus der Sammlung Sigg haben wir 12 Kapitel gebildet», schreiben die Ausstellungsmacher im hervorragenden Katalog.
Dabei sind es nicht nur laute oder tabubrechende Kapitel wie die «Machtspiele», wo es auch um die Selbstzerfleischung der Menschen geht oder um den Körper als Kunstwerk, wo bewusst mit Schockwirkungen gespielt wird. Im Kapitel «Konsumismus» etwa wird das in China grassierende Konsum- und Markenbewusstsein thematisiert – Chanel-Werbung kombiniert mit Politpropaganda ergibt hier so etwas wie eine chinesische Variante der Pop-Art. Und deren bekanntester Vertreter, Andy Warhol, ist für manche ein Held: Maos Porträt vermischt mit Liz Taylor und Marilyn Monroe ergibt einen schön explosiven Mix.
Die uralte Stille des Tao
Überhaupt spielt nach der jahrzehntelangen Abschottung die Auseinandersetzung mit der westlichen Kunst eine wichtige Rolle. Ihr ist eine ganze Saalfolge im Kunstmuseum gewidmet. Und so kann es sein, dass hier auf einem Gemälde plötzlich Mao, wiederum, bewundernd vor dem bekannten Pissoir von Marcel Duchamp steht, als ob diese einst verpönte Ikone der modernen Kunst eine neue Errungenschaft des sozialistischen Aufbaus wäre.
Aber dann ist in «Mahjong», wie gesagt, auch wieder die Stille da. Man trifft auf jene uralte Tradition, die China für den Westen so attraktiv macht: die Schrift und die Gegenwart der meditativen Leere. Nirgendwo wird das deutlicher als im grossen Hodler-Saal, wo die Bilder von Qiu Shihua hängen. Weiss sind sie auf den ersten Blick. Nach und nach aber, wenn sich das Auge daran gewöhnt hat, taucht zart wie eine Fata morgana eine weite Landschaft mit Bergen, Wäldern und Tälern auf der Leinwand auf. Und der Blick versinkt darin und schweift nach China weg.
Dem ohrenbetäubenden Sturz Maos und dem Sound der Marktwirtschaft folgt hier das behutsame, philosophische Tao: «Dein Weg ist der Weg der Geschäftigkeit. Mein Weg ist der Weg des Nichttuns, bei dem nichts ungetan bleibt: Der Weg der Stille und Ruhe, aus dem das rechte Bewegtsein entspringt», wie Lao Tse das vor Jahrhunderten formulierte.
«Die Sammlung ist im Kopf»
Sein Wohnschloss in Mauensee LU ist ein lebendiges Museum: Wie Uli Sigg zum Pionier der China-Kunst wurde.
Das muss man erst können, mehr als 1000 Kunstwerke präsent haben – nicht nur in den wunderbaren alten Räumen in Schloss Mauensee, nicht nur in vielen Depots, sondern auch im Gespräch: «Ich habe meine ganze Sammlung im Kopf», sagt Uli Sigg, der 59-jährige Unternehmer und Vizepräsident des Verwaltungsrates der Ringier-Gruppe.
Pionier und Botschafter
Und das muss man hinbringen: weltweit die grösste Sammlung chinesischer Gegenwartskunst zusammentragen. Dass er all seine Werke im Kopf hat, hängt damit zusammen, wie er sie gesammelt hat. Sigg, ursprünglich Journalist, war in den Siebzigerjahren für die Firma Schindler AG tätig, für die er das China-Geschäft aufbaute. Er etablierte 1980 das erste Jointventure-Unternehmen zwischen China und dem Westen. Und wurde auch sonst zum Pionier: «Ich habe mich schon immer für zeitgenössische Kunst interessiert. Und da lag es nahe, mich auch in China mit der aktuellen Kunst zu beschäftigen. Es ging darum, einen Zugang zu einem weiteren Feld der Kunst zu entdecken – und über die Kunst einen neuen Bezug zu China zu finden.»
Diese illegale Kunst sei zuerst noch nicht besonders interessant gewesen. Und Sigg konnte sich aus geschäftlichen Gründen auch nicht exponieren. 1995 wurde er als Quereinsteiger zum Botschafter der Schweiz in der Volksrepublik China, in Nordkorea und in der Mongolei berufen. «In dieser Funktion habe ich meine ganze Freizeit investiert, um eigene Recherchen im Bereich der aktuellen Kunst zu machen.» Diese hatte sich entwickelt und befreit und eine über China hinaus interessante Formensprache entwickelt. Kunstmagazine aus dem Westen öffneten neue Sichtweisen, der bekannte Pop-Art-Künstler Robert Rauschenberg war lange in China und hatte, wie Sigg weiss, grossen Einfluss auf die jungen Künstler.
Intensität und Energie
Sigg besuchte die damals inoffiziellen Künstler – kein leichtes Unterfangen, da es kaum ein Informationsnetz gab. Eben deswegen erklärt sich der persönliche Zugang des Sammlers: «Jedes Werk hat seine eigene lange Geschichte – bis ich es gefunden, ausgewählt, gekauft und in die Schweiz gebracht hatte.»
Die Sammlung legte er als «Gedächtnis» der Epoche des Umbruchs seit 1979 an – «ob mir die Kunstwerke persönlich gefallen oder nicht. Es geht um ihre Intensität und Energie.» Er selbst legte diese einmalige Energie und seine Kunstszene-Kenntnis auch nach seiner Demission als Botschafter 1998 weiter in sein Kunstprojekt. Er schrieb den in China ersten Preis für neue Kunst aus, um neue Kontakte mit Künstlern zu knüpfen. In die Jury berief er Harald Szeemann, der das Potenzial und die Sprengkraft dieser Kunst sofort erkannte und sie 1999 an die Biennale von Venedig brachte (siehe oben).
Bis heute ist Sigg tätig im Brückenschlag zwischen der Schweiz und China. So begleitet er beratend auch das Architektenteam von Herzog & De Meuron, welches den Wettbewerb um den Bau des Olympischen Nationalstadions in Beijing gewonnen hat.
Sigg ist auch in der westlichen Kunstwelt eine bekannte Persönlichkeit – nicht nur weil er als der Kenner chinesischer Kunst gilt und sofort erkannt wird. An Ausstellungen, an Kunstmessen und Biennalen sieht man ihn immer wieder: wie er lange vor einzelnen Werken stehen bleibt und in sie hineinzutauchen scheint. Ebenso gelangen all diese Kunstwerke in seinen Kopf. Seine imaginäre «Ausstellung im Kopf» muss noch um ein Vielfaches grösser sein als die immense China-Sammlung.kt
Ausstellung: Kunstmuseum Bern, Hodlerstrasse 8–12. 13. Juni bis 16. Oktober. Di 10–21 Uhr, Mi bis So 10–17 Uhr. – Holcim Holderbank AG (SBB-Verbindung über Olten oder Brugg). Bis 28. August. Di bis Sa 14–18 Uhr (Eintritt gratis). Vernissage: Sonntag, 11 Uhr. Katalog: Matthias Frehner und Bernhard Fibicher (Hrsg.): «Mahjong – Chinesische Gegenwartskunst aus der Sammlung Sigg». Hatje Cantz, 360 Seiten, 364 Farbabbildungen, 65 Franken. Sonderveranstaltungen (Führungen, Filme, Vorträge, Podiumsdiskussionen): Auskünfte über 031 328 09 44 oder
www.kunstmuseumbern.ch
Quelle: Berner Zeitung
http://www.espace.ch/artikel_102653.html
***************************
art-in.de, 03.06.2005
Dschingis Khan und seine Erben - Bundeskunsthalle, Bonn (16.06.05 – 25.09.05)
kah
Im Jahr 2006 wird der geschichtsträchtigen Einigung der mongolischen Stämme unter Dschingis Khan vor 800 Jahren gedacht. In den riesigen Gebieten Inner- und Ostasiens, deren zentrale Territorien die Geographie heute Mongolei nennt, vermochten reiternomadische Gemeinschaften über Jahrtausende hin immer wieder mächtige Reiche aufzubauen. Das Imperium Dschingis Khans stellt den machtpolitischen Höhepunkt innerhalb dieser langen Tradition nomadischer Staatsgründungen im eurasischen Steppengürtel dar. Das größte Reich der Geschichte erstreckte sich in seiner Blütezeit vom Pazifischen Ozean bis Mitteleuropa und wurde in seiner Entwicklung durch eine Vielzahl von Völkern und Kulturen nachhaltig geprägt.
Die Mongolen waren nicht nur erfolgreiche Eroberer, sie vermochten es auch, ihr riesiges Herrschaftsgebiet souverän unter Kontrolle zu halten. Effektive Verwaltungsstrukturen, die Förderung des Handels, modernes Postwesen und Papiergeld, schließlich eine weitgehende religiöse und kulturelle Toleranz bildeten das Fundament der sogenannten Pax Mongolica: Bis ins 16. Jahrhundert hinein blühte der Austausch zwischen Europa und Asien mit noch nie da gewesener Intensität, über Handelswege gelangten nicht nur Waren, sondern auch Ideen und zivilisatorische Errungenschaften von einem Teil des Imperiums ins andere.
Die Ausstellung soll das mongolische Reich auf dem Höhepunkt seiner Macht vorstellen, gleichzeitig auch die vorangegangenen Traditionen und Nachwirkungen der Mongolenherrschaft bis in die heutige Zeit berücksichtigen. Erarbeitet wird das Projekt in enger Kooperation mit mongolischen und deutschen Wissenschaftlern. Seit über zwei Jahren graben Archäologen der Universität Bonn sowie des Deutschen Archäologischen Instituts die sagenumwobene Hauptstadt Dschingis Khans, Karakorum, aus. Französische und türkische Archäologen legen die mit reichen Funden ausgestattete Nekropolen der Vorläufer des Mongolenreiches frei - der Xiongnu (3. Jh. v.Chr. - 1. Jh. n.Chr.) sowie der Türken (6./7. Jh. n.Chr.). Die Grabungsergebnisse dieser Kampagnen sollen in der Ausstellung erstmalig präsentiert werden. Ein weiterer wichtiger Bereich der Ausstellung widmet sich den Nachfolgereichen des Dschingis Khan-Imperiums, wie sie bis ins 16. Jahrhundert in Asien und Europa bestanden haben. Gezeigt werden einmalige Zeugnisse kultureller Wechselwirkung zwischen den nomadischen Eroberern und den sesshaften Völker: die Goldene Horde in Russland, das Reich der Tschagatai in Zentralasien, die Ilkhanate in Persien und die Yuan-Dynastie in China und haben großartige Kunstwerke hervorgebracht, die in repräsentativer Auswahl in der Ausstellung gezeigt werden.
Als die Nachfolger Dschingis Khans vor der Notwendigkeit standen, ihrer Herrschaft durch die Einführung einer Hochreligion eine tragfähige ideologische Grundlage zu geben, entschieden sie sich für den Buddhismus. Der Hof des mongolischen Khans zeichnete sich durch eine große religiöse Toleranz aus: Neben Schamanen, nestorianischen Christen und katholischen Missionaren haben hier vor allem tibetische Buddhisten gewirkt. Die Ausstellung soll die wechselvolle Geschichte des Buddhismus im mongolischen Herrschaftsgebiet vom 13. bis zum 20. Jahrhundert nachzeichnen und durch prägnante künstlerische Zeugnisse belegen.
Schließlich soll das "lange 20. Jahrhundert" des modernen mongolischen Staates dokumentiert werden, in dem u.a. die Frage nach einer identitätsstiftenden Rolle und Tradition Dschingis Khans immer wieder virulent wird.
Die Ausstellung wird ca. 400 Exponate umfassen: u. a. neueste archäologische Funde, Waffen und Rüstungen, kostbar illuminierte Manuskripte und historische Karten, Textilien, Keramik und sakrale Kunstwerke. Ein wissenschaftliches Katalogbuch wird die Präsentation begleiten. Darüber hinaus ist ein ausstellungsbegleitender Film und eine zweiteilige TV-Dokumentation in Vorbereitung. Zwei internationale wissenschaftliche Symposien und ein umfangreiches Rahmenprogramm sind geplant.
Dschingis Khan und seine Erben Das Weltreich der Mongolen Ausstellungsstruktur
I. Xiongnu: u. a. Funde aus der mongolisch-französischen Grabung in Golmod unter d. Leitung von Jean-Paul Desroches (Musée Guimet, Paris)
II. Alttürkische Reiche: mongolisch-türkische Grabung, Funde aus den Mausoleen des Kültegin und des Bilge Khan
III. Karakorum: mongolisch-deutsche Grabungen in der Stadtmitte und im Palastbezirk unter der Leitung von Prof. Hans-Georg Hüttel (KAVA/ DAI Bonn) und Dr. Ernst Pohl (Universität Bonn)
IV. Dschingis Khan und sein Weltreich: unter anderem das Dschingis Khan-Portrait aus dem Nationalen Palastmuseum Taipei und der "Stein des Dschingis" aus der Eremitage St. Petersburg
V. Nachfolgereiche: a) Versuch der Eroberung Europas (Ungarn, Polen - Liegnitz, Heisterbach) b) Goldene Horde in Russland (Eremitage) c) Tschagatai in Zentralasien (anhand Karte) d) Ilkhanat in Persien (diverse Leihgeber: Berlin, Kopenhagen, u.a.) e) Yuan-Dynastie in China (Taipei, Musée Guimet u.a.) f) Versuch der Eroberung Japans (Nationalmuseum Tokyo u.a.)
VI. Buddhismus - das Kloster Erdenezuu
VII. Die Mongolei und ihr "langes" 20. Jh.
Abbildung: Anonymer Künstler, Porträt des Kaisers Taizu (Dschingis Khan), Yuan-Dynastie, 14. Jh., Albumblatt, Tusche und Farben auf Seide, Höhe 74,1 cm, Breite 116,1 cm, © Nationales Palastmuseum Taipeh, Taiwan – nur in Bonn
Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland Friedrich-Ebert-Allee 4, 53113 Bonn, Telefon 0228-9171-204/5/6, bundeskunsthalle.de
http://www.art-in.de/inckah2.php?id=897
***************************
taz Berlin, 3.6.2005
Die Gespenster der Kulturrevolution
Die chinesische Komponistin Liu Sola ist eine überzeugte Grenzgängerin. Nun bringt sie ihre Freunde aus New Yorks Avantgarde-Szene nach Berlin
VON DANIEL BAX
"Was soll ich sagen", seufzt Liu Sola mitten im Gespräch: "Chinesin zu sein ist nicht einfach. Gerade meine Generation hat Erfahrungen gemacht, die für vier Generationen ausreichen würden." Da war das Gespräch gerade auf das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens am 4. Juni 1989 gekommen, mit dem die Studentenrevolte blutig endete. An jenem Tag war Liu Sola gerade in Memphis, Tennessee, und nahm mit amerikanischen Blues-Musikern einen Song namens "Reborn" auf: den ersten chinesischen Blues-Song.
Musikalisch gesprochen, hat Liu Sola schon mehr als eine Wiedergeburt erlebt. In die USA war sie, mit einem Stipendium ausgestattet, schon 1987 gegangen. Nach einer Episode in England kehrte sie sechs Jahre später nach New York zurück, um mit dem Dub-Produzenten Bill Laswell zu arbeiten. So lernte sie nach und nach all jene Vertreter der New Yorker Avantgarde-Szene kennen, die sie als musikalische Kuratorin des "In Transit"-Festivals jetzt nach Berlin geladen hat: Den Extrem-Saxofonisten John Zorn, der mit Bill Laswell am Bass ins Haus der Kulturen der Welt kommen wird, den FreeJazz-Posaunisten Roswell Rudd oder die persische Sängerin Sussan Deyhim. "Das sind nicht nur meine Freunde. Sie haben mich auch inspiriert, was ihre Haltung und Herangehensweise angeht", bekennt Liu Sola.
Man mag die Praxis des HKW fragwürdig finden, die immer gleichen Künstler in wechselnden Funktionen einzuladen, um dem Haus dadurch Profil zu verleihen. Doch im Fall von Liu Sola, die im künstlerischen Beirat des HKW sitzt und schon öfters für Konzerte zu Gast war, ist es ein kleiner Glücksfall: Als Kuratorin ermöglicht sie dem Publikum nun einen intimen Einblick in die New Yorker Avantgarde-Szene. Und als Musikerin zählt sie selbst zu den interessantesten Figuren ihres Landes: Zwischen Rockopern, Elektronik-Experimenten und futuristischem Folk bewegt sich ihr Oeuvre.
Als Kind der Kulturrevolution gehörte Liu Sola einst der ersten Klasse an, die 1977 auf dem Konservatorium aufgenommen wurde, als dieses wieder geöffnet wurde: Zehn Jahre lang war es während der Kulturrevolution geschlossen geblieben. Ihr Vater war ein hochrangiges Parteimitglied, das in Ungnade fiel, ihre Mutter eine Schriftstellerin, die von Mao Tse-tung persönlich kritisiert worden war: Acht Jahre verbrachten die Eltern im Gefängnis, während sich ein Kindermädchen um Liu Sola kümmerte. Über ihre Zeit am Konservatorium schrieb Liu Sola ein Buch, das unverhofft zum Bestseller avancierte. Mit ihrer Geschichte über einen jungen Komponisten und seinem Kampf mit der Gesellschaft und ihren Konventionen traf sie einen Nerv bei ihrer Generation, die sich vom System gegängelt fühlte.
Seitdem hat sich die Situation in China grundlegend geändert: Es ist heute weniger der Staat, der dem künstlerischen Ausdruck enge Grenzen steckt, als der Markt mit seinen Gesetzen. "Was mich beunruhigt, ist, dass die traditionelle Musik allmählich verloren geht", sagt Liu Sola. "Die traditionellen Musiker stehen entweder im Dienst der Regierung. Oder sie versuchen, ins Popgeschäft zu wechseln, und verschwenden dabei ihr Talent. Es gibt in China einfach zu viel schlechte Popmusik, zu wenig gute", bedauert sie.
Mit ihrer neuen Gruppe "Liu Sola & Friends" versucht sie nun, mit traditionellen Instrumenten wie der Laute Pipa oder der Zither Zeng einen zeitgemäßen Ausdruck für das chinesische Erbe zu finden. Dafür studiert sie schamanistische Lieder aus dem alten China, in denen sie Parallelen zu afrikanischer Musik, zu Rock und zur Dance-Musik sieht. Und sie umgibt sich mit einigen der besten Solisten ihres Landes, denen sie einiges an Experimentierfreude abfordert: "Ich möchte nicht, das wir im Stil der westlichen Avantgarde oder der Neuen Musik spielen", sagt Liu Sola. "Man muss dem Geist der Instrumente gerecht werden."
Vor zwei Jahren ist Liu Sola, die inzwischen als eine Art Mutter der chinesischen Avantgarde gilt, wieder zurück nach Peking gezogen. "In New York habe ich von John Zorn und Bill Laswell gelernt, wie man Platten produziert. Ich hoffe, etwas von diesem Geist nach China tragen zu können." Vor zwei Jahren hat Liu Sola ein eigenes Label gegründet. Ihre Platten werden in China aber über einen großen Verlag vertrieben, weil sie dort vor allem als Autorin bekannt ist: Ein paar Romane und mehrere Bücher über chinesische Musik, Kunst und Design hat sie geschrieben.
Im kommenden Jahr wird Liu Sola für das Programm "China Culture Memory" am Haus der Kulturen der Welt eine Oper komponieren, die einen Bogen von der chinesischen Revolution in den Dreißigerjahren bis heute schlägt. Sie soll Arbeiten einiger Komponisten integrieren, mit denen Liu Sola einst am Konservatorium studierte und in deren Werk sich die unterschiedlichen Biografien spiegeln. "Viele von ihnen sind heute selbst Professoren, in China oder den USA", sagt Liu Sola. "Sie waren immens einflussreich und die Ersten, die sich als Komponisten außerhalb Chinas etablieren konnten."
So schließt sich der Kreis.
Festival "In Transit" (2.-18. 6.), Konzert Liu Sola & Friends: 5. 6.
http://www.taz.de/pt/2005/06/03/a0257.nf/text.ges,1
__________________
with kind regards,
Matthias Arnold
(Art-Eastasia list)
http://www.chinaresource.org
http://www.fluktor.de
__________________________________________
An archive of this list as well as an subscribe/unsubscribe facility is
available at:
http://listserv.uni-heidelberg.de/archives/art-eastasia.html
For postings earlier than 2005-02-23 please go to:
http://www.fluktor.de/study/office/newsletter.htm