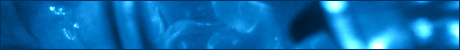[achtung! kunst] *Deutschsprachiges Gebiet* Musik: Liu Sola - Köln: Himmel in der Pinselspitze - Tienanmen: Masse und Macht - Wanderung durch die chinesische Bergwelt
BZ, 01. Juni 2005
John Zorn hat meine Karriere zerstört
Liu Sola über traditionelle und neue Musik, die Kraft der Dissonanz und ihr Heimatland China
Für das diesjährige InTransit-Festival im Haus der Kulturen der Welt haben Sie die Konzertreihe kuratiert und so unterschiedliche Künstler wie John Zorns Painkiller, das Ensemble Modern, Roswell Rudd und Sussan Deyhim eingeladen. Wie kam die Auswahl zustande?
Sie inspirieren mich einfach. Ich habe zeit meiner Karriere mit Vertretern der klassischen und zeitgenössischen E-Musik gearbeitet, mit Musikern aus den Bereichen Pop, Folk und Jazz - aber dieser Gruppe von Künstlern fühle ich mich wirklich verbunden. Sie denken nicht in Kategorien, sie lassen sich von Pop bis Avantgarde von allen möglichen Dingen beeinflussen. Und sie sind auch technisch sehr gut. Sie sind einfach cool. Immer, wenn wir zusammen sind, sagen wir uns: Wir machen keinen Scheiß.
Was darf man von Ihrer Show erwarten?
Ich werde mit einem chinesischen Ensemble auftreten, das mit chinesischen Instrumenten spielt.
Traditionelle chinesische Musik?
Nein, das sind schon meine Kompositionen. Aber, was ich versuche, ist, einen neuen Sound für chinesische Musik zu finden.
Warum gebrauchen Sie dazu traditionelle Instrumente?
Weil sie für meine Herkunft stehen. John Zorn und seine Leute sind mit Rock, Jazz und Metal aufgewachsen und entwickeln das auf ihre Weise weiter. Und ich bin mit chinesischer Musik aufgewachsen. Wenn ich das mit herkömmlichen Jazz- und Rock-Instrumenten kombinieren würde - was ich früher einmal getan habe -, dann käme mir das falsch vor, wie eine Imitation. Außerdem haben chinesische Instrumente eine ähnliche Energie wie elektronisch verstärkte. Nehmen Sie zum Beispiel die Pipa, die chinesische Laute. Damit kann man wirklich tödliche Geräusche machen.
Sie versuchen demnach die traditionelle chinesische Musik weiter zu entwickeln?
Ich versuche, die verlorene Energie wieder zu entdecken. Über Jahrtausende hat man die Energie der chinesischen Musik reduziert und reduziert. Von den Dynastien bis zu Mao war sie stets dazu da, das System zu stabilisieren. Weil man davon ausging, dass Lautstärke und Dissonanzen die Bevölkerung unnötig aufwühlen würden, hat man sie Stück für Stück simplifiziert.
Und das versuchen Sie nun rückgängig zu machen?
Genau. Was ich erschaffe, hat im Grunde bereits früher schon existiert. Ich hole es nur wieder aus den Instrumenten heraus.
Bis Sie selbst zu chinesischer Musik gefunden haben, hat Ihre Karriere einen recht abenteuerlichen Weg genommen.
In der Tat. Ich habe am Konservatorium klassische Komposition studiert - die Fuge - und nach meinem Abschluss sogar noch kurze Zeit die Kunst der Fuge unterrichtet. Aber dann dachte ich, dass Rockmusik interessanter ist. Also habe ich eine Rockoper komponiert. Die klang leider sehr nach Pink Floyd, na ja, andere Rockmusik kannte man in China damals leider nicht. Die Leute hier in China hielten mich für verrückt. Denn zeitgleich hatte ich auch als Schriftstellerin einen Beststeller auf dem Markt. Ich war also die klassisch gebildete Komponisten, die landesweit als Schriftstellerin zu Ruhm kam und nebenbei Pink-Floyd-artige Rockopern schrieb. Abgesehen, dass das aus heutiger Sicht ziemlich albern scheint, war das vor 20 Jahren in China schon ein starkes Stück. Also hab ich das Land verlassen.
Wollten Sie es für immer verlassen?
Ja, ich dachte: China, Goodbye! Ich war allerdings schon vorher einmal in den USA gewesen. Die Regierung hatte mich 1986 eingeladen, weil ich als irgendwie kontroverse Künstlerin aus China für die natürlich sehr interessant war. Und obwohl ich Amerika bis dahin nie reizvoll fand, hab ich die Einladung angenommen. Bei meinem ersten New-York-Besuch hat man dann ein Privatkonzert für mich organisiert, das mein Leben verändert hat. Der Bluessänger Junior Wells ist nur für mich aufgetreten, und ich habe etwas in seiner Stimme gehört, dass ich vorher nie gespürt habe. Ich dachte, wenn ich mit meiner Musik je ähnliche Gefühle auslösen könnte, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Ich wusste, dass all die Musik, die ich bis dahin gemacht habe, Mist war. Also bin ich mit der Entscheidung nach China zurück, dass ich das Land verlassen muss. Ich wollte noch mehr lernen.
Und dann sind Sie in die USA gegangen?
Nein, zunächst bin ich für fünf Jahre nach England, von 1988 bis 1993. Dort geriet ich allerdings in die Weltmusik-Szene um Peter Gabriel und das Womad-Festival. Ich hatte sogar ein Management, das versucht hat, mich als chinesische Reggae-Sängerin zu vermarkten. Aber ich wollte nicht die niedliche Asiatin sein, die sich karibisch gibt. Sie können sich gar nicht vorstellen wie sehr ich mich bei diesem Niedlichkeitsgetue gelangweilt habe. Aber zurück zur klassischen Musik wollte ich auch nicht. Ich fühlte mich in meiner Situation gefangen.
Wie konnten Sie sich befreien?
Ich bekam einen Vertrag bei der Plattenfirma von Bill Laswell und bin nach New York gezogen. Die Stadt hat mir wirklich die Augen geöffnet. Ich habe dort mit Ornette Coleman, John Zorn und vielen anderen gespielt, die mir sehr viel beigebracht haben. Zum Beispiel, dass man durchdrehen kann, dass man alles Mögliche machen kann, wenn man will. Das war eine wunderbare Zeit: diese Leute sind ja nicht nur auf der Bühne verrückt, sondern auch privat.
War es für Sie eine schwierige Entscheidung, 2002 wieder nach Peking zurückzukehren?
Eigentlich nicht. Zum einen ist Peking meine Heimatstadt. Und zum anderen wird China immer attraktiver, besonders für Chinesen. Viele, die im Ausland leben, überlegen, ob sie nicht wieder zurückziehen sollten. Es gibt zwar viele Dinge, die wir hier nicht haben, wie zum Beispiel eine funktionierende und lebendige Musikszene. Aber weil wir sie nicht haben, können wir sie aufbauen. Dazu gibt es heute die Möglichkeit. Und das ist interessant. Meine Zeit im Ausland sehe ich als Lehrjahre, die sehr wertvoll waren. Aber ehrlich gesagt konnte ich zu der dortigen Musikszene nur wenig beitragen. Sie existierte bereits und hat sich über Generationen entwickelt. In China kann ich viel mehr leisten.
Aber Sie hätten auch ein großer Reggae-Star werden können und würden heute vielleicht in Saus und Braus leben.
Ja, wenn mir John Zorn nicht über den Weg gelaufen wäre. Er hat meine Karriere zerstört. Alles hätte so einfach sein können.
Das Gespräch führte Harald Peters.
http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/feuilleton/453570.html
***************
Liu Sola
Geboren 1955 in Peking, ist Liu Sola heute eine der bedeutendsten Musikerinnen in China.
Nach Umwegen über E-Musik, Bombastrock, Reggae und Free Jazz tritt sie inzwischen nur noch mit einem traditionellen chinesischen Ensemble auf.
Ihre Musik hört sich an wie eine Mischung aus Minimal Techno, Kate Bush und den Einstürzenden Neubauten.
Im Haus der Kulturen der Welt kuratiert Liu Sola die Konzertreihe des diesjährigen InTransit-Festivals. Dabei tritt sie auch selber auf: zur Eröffnung am 2. Juni um 20.30 Uhr in einer Performance mit dem Tänzer Koffi Kôkô und am 5. Juni um 20 Uhr mit ihrem Ensemble.
Das Gespräch mit Liu Sola fand in ihrem Wohnhaus, einer ehemaligen Munitionsfabrik, in Peking statt.
http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/feuilleton/453566.html?2005-06-01
*****************************
taz Köln, 27.5.2005
Subtile Referenzen an den Westen
Mit viel Phantasie, kritischem Witz und handwerklichem Können sorgten junge Künstler aus China noch vor einigen Jahren auf dem Kunstmarkt für Furore und Umsatz. Geprägt waren ihre Werke zum Teil durch überdeutliche technische, formale und inhaltliche Anleihen bei ihren westlichen Kollegen. Inzwischen ist der Hype vorbei, und das Kölner Museum für Ostasiatische Kunst schiebt mit "Himmel in der Pinselspitze" eine Ausstellung über "Chinesische Malerei des 20. Jahrhunderts" nach.
Ein in die Irre führender (Unter-)Titel. Denn zwar werden in chronologischer Folge Arbeiten aus einem ganzen Jahrhundert gezeigt. Es fehlen jedoch die sozialistischen Realisten und die junge Generation, die sich ausdrücklich nach Westen orientiert. Stattdessen verfolgt die Ausstellung im Wesentlichen den Strang der traditionellen "Literatenmaler", deren zentrales Thema die Stellung des Menschen in und zu der Natur ist. Dabei kommt es nicht auf deren realistische Wiedergabe an, sondern auf Stimmungen. Dies sollte dem Betrachter die Meditation erleichtern.
So wirken die rund 50 ausgestellten Bilder - meist Hängerollen aus eigenen Beständen - von etwa 25 Künstlern auf den ersten Blick "klassisch" in Technik und Thema. Sie zeigen majestätische Landschaften mit nebelverhangenen Bergen, die demütig-winzigen Menschen, die Vogelperspektive, Stillleben, die frei im Raum zu schweben scheinen. Alles gekonnt getuscht.
Doch auch diese Maler griffen Einflüsse aus Japan und dem Westen auf, allerdings nicht so offensichtlich wie ihre jungen Kollegen. Diese Übernahmen zu erkennen, bedarf es des geübten Blicks auf das Bild. Hilfe leisten die Schrifttafeln und der Katalog, die auch von den politischen Bedingungen erzählen, unter denen die Künstler arbeiteten - mal wurden sie gefördert, oft genug verfemt. Zu entdecken sind etwa Farbabstufungen, die aus der Ölmalerei kommen, oder westliche Lichteffekte und expressive Formen. Fazit: eine anspruchsvolle Ausstellung über eine wichtige Facette chinesischer Kunst. Leider unter falschem Titel.
JÜRGEN SCHÖN
"Himmel in der Pinselspitze - Chinesische Malerei des 20. Jahrhunderts": Museum für Ostasiatische Kunst Köln, Universitätsstr. 100, bis 25.9., Di-So 10-18 Uhr, Do 10-20 Uhr,
Ausstellungskatalog 19,80 Euro
http://www.taz.de/pt/2005/05/27/a0015.nf/text.ges,1
*****************************
28. Mai 2005, Neue Zürcher Zeitung
Masse und Macht
Ein Rundgang über den monumentalen Tiananmen-Platz in Peking
Hauptstädtische Plätze sind eine Visitenkarte für die Geschichte und die Kultur eines Landes. Pekings Platz des Himmlischen Friedens, der Ort des Studentenmassakers von 1989, demonstriert die Arroganz, Bedrohlichkeit und Verletzlichkeit totaler Macht.
Von Urs Schoettli
Jedes Jahr, wenn in der Grossen Halle des Volkes das Plenum des Nationalen Volkskongresses zusammentritt, und alle vier Jahre, wenn in demselben stalinistischen Gebäudekomplex die Delegierten des Kongresses der Kommunistischen Partei sich versammeln, wird der Platz (vor dem Tor) des Himmlischen Friedens von Polizei, Militär und Geheimdienstagenten hermetisch abgeschlossen. Wie zu den Zeiten, als hinter den Mauern der Verbotenen Stadt die Kaiser residierten, wird auch heute den Untertanen der Kontakt zu den Mächtigen, die über ihr Schicksal befinden, rigoros verwehrt. Bloss bei sorgfältig orchestrierten Inspektionsreisen der Parteibosse vermag der eine oder andere einen Blick auf die Spitze der herrschenden Dynastie zu werfen.
IMPERIALE DIMENSIONEN
Der Tiananmen-Platz gilt als der grösste Platz der Welt. Seine Dimensionen sind so enorm, dass man ihn eigentlich gar nicht als geschlossene Einheit wahrnimmt. Traditionelle städtebauliche Eckpunkte sind der Zugang zur Verbotenen Stadt und das ihm direkt gegenüber stehende Haupttor, Qianmen. Dessen beide mächtige Gebäude gehörten einst zu den Wehrbauten, welche die dem Kaiserpalast vorgelagerte Altstadt umschlossen. Flankiert wird der Platz des Himmlischen Friedens von einer wilden Mischung von Baustilen. Einzelne Gebäude lassen den russischen Einfluss zur Zeit der vorletzten Jahrhundertwende erkennen, während die beiden monumentalen Komplexe des Museums zur Geschichte der chinesischen Revolution und der Grossen Halle des Volkes das neue Zeitalter des kommunistischen Totalitarismus verkörpern, das mit der auf dem Tiananmen-Platz am 1. Oktober 1949 erfolgten Ausrufung der Volksrepublik begonnen hat. Zum seit einiger Zeit nicht mehr genutzten Erbe dieser jüngsten über das Reich der Mitte herrschenden Dynastie gehören auch die den Aussenmauern der Verbotenen Stadt vorgelagerten Tribünen, die einen an die Paraden erinnern, die zur Hochzeit des realsozialistischen Monumentalismus von Pankow bis Pjongjang zu den Ritualen der Herrschaft des Proletariats gehört hatten. Im Mittelpunkt des imperialen Platzes steht das Mausoleum mit dem mumifizierten Staatsgründer Mao und davor das in der Tradition kaiserlicher Stelen gestaltete Denkmal für die Helden des Volkes.
Es wird in jüngster Zeit in westlichen Medien viel über einen frisch erstarkenden chinesischen Nationalismus spekuliert. Da die ideologische Legitimität der Kommunistischen Partei längst einem ausgeprägten macht- und wirtschaftspolitischen Pragmatismus hat Platz machen müssen, sei, so lautet das Argument, Peking verstärkt gezwungen, auf der Klaviatur des Patriotismus zu spielen. Als Indiz für diese Entwicklung gelten auch die jüngsten antijapanischen Proteste. Wer die neuere Geschichte des Reichs der Mitte aufmerksam studiert und auch das distanzierte Verhältnis der Chinesen zum Staat, ja zu jeder den Familienverband übersteigenden Gemeinschaft berücksichtigt, wird hinter die These vom Nationalismus ein grosses Fragezeichen setzen müssen. Jedenfalls lassen sich im Alltag, wenn sich auf dem Tiananmen-Platz die Massen der Besucher aus allen Gegenden des Riesenreiches tummeln und die imposanten Zeugnisse der Staatsmacht vorgezeigt bekommen, keine Zeichen einer patriotischen Ergriffenheit erkennen. Die Gruppen benehmen sich beim Rundgang durch die Grosse Halle des Volkes oder durch den Kaiserpalast viel lauter und respektloser als etwa die Besucher im Schweizer Bundeshaus. Abends beim Einzug der riesigen Fahne, die gegenüber dem Eingangstor zur Verbotenen Stadt mit dem weltbekannten und seit dem Tiananmen-Massaker infamen Porträt von Mao flattert, zieht ein kleiner Trupp von Soldaten auf. Die jungen Männer, die im Blitzlichtgewitter blinzeln, machen im Vergleich mit den Wachen, die in London oder Washington aufmarschieren, einen harmlos bäuerlichen Eindruck.
In jüngster Zeit haben Chinas eindrückliche wirtschaftliche Fortschritte von Tokio bis London und Washington die Sicherheitsstrategen auf den Plan gerufen. Wieder einmal geht des Gespenst von der «gelben Gefahr» um die Welt, und in einem unlängst veröffentlichten Bericht sieht die amerikanische Heritage Foundation das Reich der Mitte als «eine aufstrebende Macht in der Weltpolitik», die sich immer ausgeprägter zum Hauptgegner der USA entwickeln werde. Es gebe kaum eine internationale Herausforderung, in welcher Peking nicht eine Rolle spiele. «Mit seiner immer stärker entwickelten Machtbasis, die sich aus Wirtschaftswachstum, politischer Stabilität und wachsenden militärischen Kapazitäten nährt, sieht China sein Wiedererstehen als eine eigenständige Weltmacht als eine Gewissheit an.»
VERLETZLICHKEITEN
Tatsache ist, dass ein Blick hinter die in mancher Hinsicht Potemkinschen Kulissen staatlicher Allmacht ein China enthüllt, das enorme Verletzlichkeiten aufweist. Wie kann man von politischer Stabilität sprechen, wenn ein einzelner Bürger, der auf dem Tiananmen-Platz ein Protestplakat hochhält, gleich von einer Gruppe von Sicherheitsagenten abgeführt wird. Tiananmen ist umringt von den Institutionen absoluter Macht, die weder durch eine Religion noch durch eine Bürgergesellschaft in Schranken gehalten wird, und dennoch ist gleichzeitig stets die Zerbrechlichkeit dieser Herrschaftsbasis fühlbar. Die ausgedehnte Anlage der Verbotenen Stadt hat trotz ihren riesigen Dimensionen die Verletzlichkeit aller menschlichen Ambitionen an sich. Es ist keine Festungsanlage, welche die Menschen abschreckt. Ihre Türme und Mauern bestechen eher durch ästhetische denn militärische Qualitäten. Und dennoch steht der Sitz der letzten chinesischen Kaiser als Mahnmal für politische Traditionen, die bis heute den Übergang vom Untertanen zum mündigen Bürger verwehrt haben. Die Grosse Halle des Volkes beherbergt die Sessionen eines Parlaments, das nichts zu sagen und nichts zu kontrollieren hat.
Das Museum der Revolutionsgeschichte lehrt eine Geschichte, die der Propaganda verpflichtet ist, und im Mittelpunkt des Platzes liegt noch immer der Leichnam eines Mannes aufgebahrt, der zu den grössten Massenverbrechern der Menschheit gehört. Nirgendwo um den Tiananmen-Platz herum gibt es eine Institution, welche die staatliche Machtfülle brechen könnte - ausser am südlichen Ende des Platzes, wo das Gewirr der Basars des alten Peking beginnt. Hier herrscht die Umtriebigkeit von Märkten und Geschäften in orientalischer Buntheit. Die Uniformität, welche der Maoismus gebracht hatte, ist längst geschwunden. Noch gibt es keine politische Wahl, doch auf dem Markt sind wie seinerzeit bei der industriellen Revolution in Grossbritannien die alten Hierarchien und feudalistischen Abhängigkeiten längst zerbrochen worden.
Dass auf dem Platz des Himmlischen Friedens nicht notwendigerweise Friedhofsruhe zu herrschen braucht, davor fürchtet sich die Obrigkeit. Unvergessen sind die Manifestationen im Frühling 1989, die blutig niedergeschlagen wurden. Noch immer ist dies eine teure Rechnung, die dereinst zu begleichen sein wird. Zu den die Zeiten übergreifenden Idealen der chinesischen Staats- und Gesellschaftslehre gehört die Harmonie, der himmlische Frieden. Unter dieser das Mandat des Himmels rechtfertigenden Ordnung pflegt sich das Reich der Mitte seit Urzeiten in stolzer Abgrenzung zur tribalistischen Zerstrittenheit der Barbaren und zur Anarchie als Zentrum der zivilisierten Welt zu sehen. Heute ist China mit der Herausforderung konfrontiert, dass eine immer komplexere Gesellschaft nach neuen Instrumenten der Machtkontrolle und Machtteilung ruft, mit denen allein zu gewährleisten ist, dass die dunklen Wolken des Absolutismus, die noch immer über dem Platz des Himmlischen Friedens dräuen, sich ohne eine gewitterhafte Entladung verziehen können.
http://www.nzz.ch/2005/05/28/li/articleCT4ON.html
*****************************
F.A.Z., 23.05.2005
Regenkunstkurs
22. Mai 2005 "Himmelsberge" nannte sich vor Jahresfrist eine Pariser Ausstellung mit chinesischer Landschaftsmalerei. Da waren sie zu sehen: endlos hintereinander gestaffelte Bergspitzen, deren letzte im Tuscheflor kaum noch auszumachen waren. Mi Youren etwa hat im zwölften Jahrhundert ein subtiles Panorama gezeichnet, in dem sich die Bergzüge wie Wellenkämme im Unendlichen verlieren. Die farbige chinesische Malerei jener Zeit nahm für solche Effekte den uns seit der Renaissance vertrauten Übergang von Braunrot im Vorder-, Grün im Mittel- und Blau im Hintergrund vorweg. Doch wie erzielte Mi seine Tiefenwirkung mit bloßer schwarzer Tusche? Zur Antwort muß man eine Wanderung durch die chinesische Bergwelt machen (für ideologiefeste Antikommunisten sei besonders Taiwan und dort der Weg zum Aussichtspunkt auf dem Alishan angeraten), und es muß regnen. Das geschieht leichter, als man hoffen möchte. Wie man in fernöstlichen Städten als Fotograf rasch den Hokusai-Blick entwickelt, der Lampions, Architekturverzierungen, Terrassengeländer oder Tore in den Vordergrund der Perspektive rückt, so weckt ein Regensturm beim Anstieg auf den Alishan lebenspraktisch die Erinnerung an jene bedauernswerten Spaziergänger im Werk des japanischen Holzschnittvirtuosen, denen erst der Wind ihre Schirme verweht und die dann ihr Tempo in den Sturzfluten immer mehr forcieren. So nimmt der Aufstieg wenig Zeit in Anspruch, doch er bringt reiche ästhetische Erkenntnis: Nachdem zum avisierten Zeitpunkt des Sonnenaufgangs ein diffuses blaues Dämmern die Wasserwelt erhellt, schälen sich aus den Regenschwaden genau jene tuscheverwischten Felsformationen heraus, die man auf den großen Rollbildern der Kuan T'ung oder Wang Mien, Chung Ch'in-li oder Tai Chin sieht, deren Bilder schon die chinesischen Kaiser bezaubert haben. Und man versteht mit einem Mal, warum sich das Selbstporträt in der chinesischen Kunst nur im Gehäus abspielt. Selbst jenes unendlich schöne Bild des Ch'in Ying aus der Ming-Epoche, auf dem sich der Künstler winzig klein in eine grandiose Gebirgsszenerie beim Kunststudium eingezeichnet hat, beschert dem Malerzwerg doch noch ein Dach über dem Kopf. Wie hätte er sonst diese verwässerten Berge zeichnen können? Die Pleinair-Malerei ist in China nur als Soustoit-Kunst denkbar - wer als Tuschekünstler den freien Himmel einfangen will, der ziehe sich unters Dach zurück. apl
http://www.faz.net/s/Rub5A6DAB001EA2420BAC082C25414D2760/Doc~ECED7771D36334D0 BAE65F56180B06738~ATpl~Ecommon~Scontent.html
__________________
with kind regards,
Matthias Arnold
(Art-Eastasia list)
http://www.chinaresource.org
http://www.fluktor.de
__________________________________________
An archive of this list as well as an subscribe/unsubscribe facility is
available at:
http://listserv.uni-heidelberg.de/archives/art-eastasia.html
For postings earlier than 2005-02-23 please go to:
http://www.fluktor.de/study/office/newsletter.htm