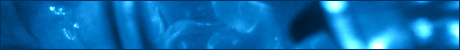schreiben für die ewigkeit
Süddeutsche Zeitung (printausgabe)
Montag, 18.Juli 2004
Schreiben für die Ewigkeit
Weltreligion - in Stein gemeißelt: Ein Heidelberger Symposium
Wir können ihn uns gut vorstellen, den kleinen buddhistischen Mönch, der einen steilen Hügel hinab riesige chinesische Schriftzeichen in einen Bergrücken aus Fels meißelt, dann mühsam wieder hochsteigt, neu ansetzt, vergessen hat, mit welchen Zeichen der Sutra er aufgehört hat und – die Zeit drängt – zur Sicherheit die letzten Zeichen noch einmal in den Stein schlägt. So stiftet der Künstler Eindeutigkeit, Neugier oder Verwirrung unter gläubigen Pilgern und genauso unter Philologen.
Jener Mönch, nennen wir ihn Seng’an Daoyi oder Fahong, lebt gegen Ende des 6. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung im kaiserlichen China und meißelt seine Zeichen gegen den Untergang der Welt. Für den gläubigen Buddhisten droht in diesen Jahren die Apokalypse, das baldige Eintreten der mofa, mithin jene unheilvolle Periode, in der die heiligen Lehren vielleicht unrettbar verloren gehen.
Gegen das Vergessen, gegen das Auslöschen des gemeinschaftlichen Gedächtnisses hilft die Bewahrung der Texte in Stein und das in einer Monumentalität, in einer Vielfalt, die alle bisherigen Zeugnisse der buddhistischen Ikonographie in den Schatten stellt. Die Schriftzeichen wachsen wie gigantische Menetekel in die Bergwände. Gewaltige Felsbrocken in aufsteigenden Tälern werden mit Inschriften versehen, die den Pilger unaufhaltsam in die Höhe ziehen, ihm das Geheimnis des Ganzen aber nie vollständig erschließen, weil er stets zu nahe oder zu weit entfernt von der Botschaft steht, mithin nur am Leibe und mit den Sinnen erfährt, was in seinem Kopf noch nicht vorgeht, weil er die Botschaft nur verstehen könnte, wenn er über ihr schwebte.
Das Weiß des Himmels
Anderthalb Jahrtausende später, für Buddhisten ist das weniger als ein Wimpernschlag, nimmt sich in Heidelberg ein Symposium dieser rätselhaften Vorgänge an. Eingeladen haben die dortige Akademie der Wissenschaften und der Professor für Ostasiatische Kunstgeschichte Lothar Ledderose, weltweit einer der angesehensten Kenner seines Fachs. Ledderose ist seit Jahrzehnten eine laterna magica der akademischen Neugier, deren ganz besondere Eigenschaft ihr unerwartetes Leuchten über bislang noch unbeschriebenen Kulturlandschaften ist.
Die Aufmerksamkeit gilt diesmal allerjüngst entdeckten oder wiederhergestellten Inschriften in den chinesischen Provinzen Shandong, Henan und Hebei. Hier erheben sich die meisten der „heiligen Berge“ Chinas und zahllose Hügel, hier liegt so etwas wie die Kernlandschaft der chinesischen Spiritualität, hier wurden mehr Klöster und Tempel errichtet – und folglich zerstört – als in allen anderen Regionen Chinas. „Dem Weiß des Himmels genauso nah wie dem Schwarz des Abgrunds“, heißt es in einem Sprichwort.
Sich um die Relikte der steinernen Zeugnisse zu kümmern, ist allerhöchste Zeit, denn was Erosion und politische Verfolgung nicht geschafft haben, dürfte bald der Tourismus erledigen. Und so galten einige blitzgescheite Referate des Heidelberger Symposiums Themen, die wahren Akademikern immer wieder die Tränen des Glücks abverlangen, weil sie zunächst einmal Fakten sichern, Zuschreibungen verifizieren, ausmessen, abklopfen, zurechtrücken – und selbst das Nichtgeschriebene noch darauf befragen, ob hier mit Absicht eine leere Stelle belassen wurde.
Vom Segen des Mangels
Soll das eine Unterscheidung zwischen fachlichem Handwerk und der Kunst der Interpretation nahelegen? Ganz gewiss nicht, dazu hängen die beiden Übungen zu eng aneinander. Es geht ja bei diesen Objekten, diesen Inschriften um das Zusammenwirken ästhetischer und kunsthistorischer, religiöser und glaubensgeschichtlicher, informativer und transzendenter Elemente. Eine in den Berg gemeißelte Sutra ist für den Betrachter schließlich zu bestimmten Zeiten ein Objekt der religiösen Verehrung (oder Herausforderung), ein einzigartiges (oder reproduzierbares) Kunstwerk, die Erinnerung an einen Text oder schlicht ein Rätsel, ein Stolperstein, der ihn tief in die Kontemplation führt.
So konnte man in Heidelberg darüber nachdenken, wie im China des 6. Jahrhunderts über das Medium des Lesens und des Schreibens nachgedacht wurde, anderthalb Jahrtausende bevor westliche Medientheoretiker dieses Denken mit ihren leeren Hochglanzbegriffen zustellten. Man erfuhr (tröstlicherweise), dass die buddhistische Vorstellung vom Ende der Welt das Wort „Ende“ naturgemäß anders, doch genauso virtuos handhabt wie die Vertreter des Christentums – und jene anfangs erwähnten Mönche Fa Hong und Seng’an Daoyi, deren Schreibkunst die Teilnehmer zusammengebracht hatte, waren am Ende der Tagung so vertraut, als hätten sie auf dem Symposium auch noch die Projektionsapparate bedient und sich zum Mittag an den Tisch gesetzt.
Es gab zwei Konferenzsprachen, Chinesisch und Englisch, nicht alle Teilnehmer beherrschten beide Idiome zu ihrer eigenen Zufriedenheit – und auch das zählt wohl zum Erfolgsgeheimnis eines geglückten Symposiums. Denn dort, wo der Mangel auftritt, wächst die Hilfsbereitschaft – und die freundliche Neugier auf das zunächst noch nicht vollkommen Verstandene. Vielleicht war das nicht der unwichtigste Subtext der Tagung: So und nicht anders redet man über Weltreligionen.
Tilman Spengler
Matthias Arnold M.A.
Digital Resources
Institute of Chinese Studies
University of Heidelberg
Akademiestr. 4-8
69117 Heidelberg
Germany
Phone: ++ 49 - (0) 62 21 - 54 76 75
Fax: ++ 49 - (0) 62 21 - 54 76 39
http://www.chinaresource.org
http://www.sino.uni-heidelberg.de
www.fluktor.de
www.zhaomo.de.vu